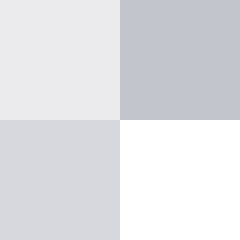Warum die politische Mitte strukturell mutiger, kulturell klarer und gesellschaftlich gestaltender werden muss.
Wenn religiöse Dogmen politische Wirkkraft entfalten, wenn Familienbilder zu ideologischen Schlachtfeldern werden und wenn „Kinderschutz“ als trojanisches Pferd für reaktionäre Narrative dient, wird aus Frömmigkeit politisches Programm. Der jüngste Artikel der Neuen Osnabrücker Zeitung über das Zusammenspiel von evangelikalen Freikirchen, russlanddeutschen Gemeinschaften und AfD-Erfolgen im Landkreis Osnabrück beschreibt ein Phänomen, das ich aus dem benachbarten Landkreis Cloppenburg nur bestätigen kann.
Was zunächst wie eine regionale Milieustudie wirkt, verweist auf eine größere politische Frage: Wo verläuft die Grenze zwischen konservativer Wertebindung und reaktionärer Abschottung – und welche Verantwortung trägt die politische Mitte, wenn diese Grenze zunehmend verwischt wird?
Konservativ – aber nicht rückwärtsgewandt
Konservatismus bedeutet für mich: gestalten mit Maß. Werthaltig statt beliebig. Behutsam statt ideologisch. Das schließt Veränderung nicht aus, sondern ein – aber in der Verantwortung für das, was Menschen Halt gibt. Konservativ sein heißt nicht, das Alte um seiner selbst willen zu bewahren, sondern das Gute vom bloß Gewohnten zu unterscheiden.
Reaktionär hingegen ist die Haltung, die Wandel grundsätzlich ablehnt. Sie verklärt vergangene Ordnungen, um aktuelle Konflikte zu bekämpfen. Und sie begründet politische Ausgrenzung mit moralischer Überlegenheit. Wer so denkt, verlässt nicht nur den demokratischen Diskurs – er entwertet auch das konservative Denken selbst.
Struktur statt Schuld: Warum die Analyse tiefer reichen muss
Die Tendenz zu reaktionärem Denken ist kein individuelles Problem, sondern hat strukturelle Ursachen:
- Ökonomische Marginalisierung: Viele Russlanddeutsche haben bei ihrer Ankunft in Deutschland strukturelle Abwertung erfahren: bei Schulabschlüssen, Berufswegen oder im alltäglichen Umgang. Anerkennung blieb aus, Teilhabe war begrenzt. Diese Kränkung wirkt bis heute – und wird politisch instrumentalisiert.
- Patriarchale Prägungen: In autoritär-religiösen Systemen wie der ehemaligen Sowjetunion oder manch traditioneller Glaubensgemeinschaft wurden starre Rollenbilder zur Überlebensform. In der BRD traf diese Prägung auf eine moderne Gesellschaft – was nicht Integration, sondern Irritation erzeugte.
- Anschlussprobleme öffentlicher Angebote: Gerade im ländlichen Raum – auch im Nordwesten – existieren durchaus vielfältige Integrations- und Bildungsangebote, etwa durch Volkshochschulen, Familienzentren oder kirchliche Träger. Es fehlt also nicht an Maßnahmen, sondern häufig an kultureller Anschlussfähigkeit: Viele dieser Angebote erreichen die zugewanderten Menschen nicht, weil sie an ihren Lebenswelten vorbeigehen. Hinzu kommt: Dort, wo etwa Schützenvereine, Nachbarschaftshilfe oder Sportvereine den sozialen Alltag prägen, wirken staatlich konzipierte Formate oft abstrakt, fremd oder unpraktisch. Dieses Vermittlungsdefizit eröffnet Räume für andere Akteure – religiöse, politische oder weltanschauliche –, die mit einfachen Antworten, klaren Zugehörigkeitsangeboten und starker sozialer Kontrolle diese Lücke besetzen.
- Mediendemokratie: Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind die Herausforderungen unserer Demokratie durch die problematischen Entwicklungen in der Medienwelt. Insbesondere die ideologisch und imperialistisch geprägte Einflussnahme der russischen Medien und die hybride Kriegsführung durch Putin und die Seinen erreichen hier in Deutschland zu viele Menschen. Hinzukommen Soziale Netzwerke, die im Zeichen libertärer Weltanschauung keine Grenzen akzeptieren.
Wer diese Zusammenhänge ignoriert, riskiert, politische Radikalisierung weiterhin nur als individuelles Fehlverhalten zu deuten. Doch das greift zu kurz. Wir brauchen eine strukturelle Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit, kultureller Exklusion und institutioneller Abwesenheit.
Reaktionär – auch ohne Religion
Zwischen autoritärer Sozialisation und kleinbürgerlicher Sehnsucht nach Ordnung
Nicht nur religiöse, sondern zunehmend auch post-religiöse Milieus zeigen eine bedenkliche Offenheit für reaktionäre Politik. Was sie eint, ist kein gemeinsamer Glaube – sondern ein geteiltes autoritäres Grundmuster.
Gerade in Teilen der russlanddeutschen Community überlagern sich autoritäre Vorerfahrungen aus der Sowjetunion mit patriarchal geprägten Familienkulturen. Die Bundesrepublik, auf die man sich lange gefreut hatte, erwies sich dann als moderner, individualistischer, pluralistischer – kurz: als fremder, als erwartet. Die Folge: ein kultureller Entfremdungsschock, der in vielen Fällen bis heute nicht aufgearbeitet ist.
Diese Enttäuschung wird nicht immer religiös verarbeitet. Auch in stark traditionell-kleinbürgerlichen Milieus ohne kirchliche Bindung sind die Deutungsmuster ähnlich: Eine instabile Welt, überforderte Politik, angeblicher Werteverfall. All das wird nicht nur beklagt, sondern personalisiert – mit Blick auf Migranten, queere Menschen, feministische Stimmen oder linke „Eliten“.
Bemerkenswert ist die Gleichzeitigkeit von Ablehnung gesellschaftlicher Vielfalt und hoher Medienaffinität: Viele in diesen Gruppen lehnen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab, informieren sich aber täglich über Telegram, Youtube oder Tiktok – oft ungefiltert, in parallelen Echokammern. Es sind keine bildungsfernen Gruppen im klassischen Sinn. Im Gegenteil: Sie sind digital vernetzt, konsumstark, oft gut organisiert – aber kulturell defensiv.
Diese Ambivalenz macht sie anschlussfähig für rechte Erzählungen. Das Narrativ vom „starken Mann“, der Ordnung schafft und Minderheiten in die Schranken weist, fällt hier auf fruchtbaren Boden. Nicht, weil autoritäre Führer glaubwürdiger wären – sondern weil sie emotional eindeutiger wirken.
Die politische Mitte: Beobachterin oder Akteurin?
Als CDU-Kommunalpolitiker bekenne ich offen: Auch wir in der politischen Mitte haben zu lange weggesehen. Aus Angst vor Polarisierung wurde der Diskurs mit religiös oder kulturell geschlossenen Gruppen oft gemieden – oder beschwichtigend geführt.
Doch Toleranz darf nicht zur Deckungsgleichheit mit Passivität werden. Die politische Mitte ist nur dann tragfähig, wenn sie fähig ist zur Abgrenzung. Nicht moralisch, sondern normativ. Nicht aggressiv, sondern bestimmt.
Deshalb braucht es klare Kriterien:
- Wer in religiöser Sprache Menschen abwertet, überschreitet eine Grenze.
- Wer Kinderschutz benutzt, um Aufklärung zu sabotieren, handelt nicht konservativ – sondern zynisch.
- Wer Diversität als „Zersetzung“ der Gesellschaft diffamiert, stellt sich außerhalb des demokratischen Konsenses.
Gleichzeitig braucht es neue Formen der kulturellen Verständigung – mit klarer Haltung und sensibler Kommunikation. Vielleicht lohnt es sich, den Dialog mit religiösen und autoritätsnahen Milieus bewusster zu suchen – nicht in Form pauschaler Annäherung, sondern mit klarem Blick für jene Linien, die eine offene Gesellschaft nicht überschreiten darf.
Pluralität als Gestaltungsaufgabe
Vielfalt ist keine abstrakte Kategorie, sondern gelebte Wirklichkeit – auch und gerade in ländlichen Räumen. Wenn sie als Bedrohung empfunden wird, liegt das oft daran, dass ihre gesellschaftliche Übersetzung fehlt.
Pluralität muss gestaltet werden – aktiv, sichtbar, wertschätzend. Das bedeutet:
- Bildungsangebote, die kulturelle Identität ernst nehmen, aber nicht verabsolutieren;
- Familienpolitik, die moderne Lebensrealitäten integriert, ohne tradierte Modelle zu entwerten;
- eine Sprache in Politik und Verwaltung, die nicht belehrt, sondern befähigt – und trotzdem deutlich bleibt;
- Möglichkeiten der konstruktiven Begegnung, die angeboten aber auch wahrgenommen werden. Integration lebt von gegenseitigem Respekt und von Akzeptanz.
Fazit: Die Mitte muss Halt geben – und Richtung zeigen
Wir leben in einer Zeit, in der demokratische Selbstverständlichkeiten infrage stehen. Nicht nur am Rand, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Dort, wo Unsicherheit in Rückzug kippt. Dort, wo Frömmigkeit in politische Abschottung führt. Dort, wo der Wunsch nach Stabilität in autoritäre Versuchung umschlägt.
Die politische Mitte darf sich nicht länger auf Moderation beschränken. Sie muss Haltung zeigen – und zwar strukturell, kulturell und institutionell:
- strukturell durch gerechte Chancen und Anerkennung,
- kulturell durch klare Wertevermittlung,
- institutionell durch eine starke Zivilgesellschaft.
Konservativ zu sein bedeutet heute: nicht zurückzuschauen, sondern Verantwortung für Richtung zu übernehmen. Es heißt: Freiheit zu schützen, wo sie bedroht wird – auch dann, wenn der Angriff von innen kommt.
Genauso zentral wie strukturelle Maßnahmen ist jedoch das, was oft unspektakulär wirkt: das gelebte Vorbild im Alltag. Gerade auf kommunaler Ebene kommt es darauf an, dass Menschen in Verantwortung – aus Politik, Sport, Kirche, Kultur und Zivilgesellschaft – Haltung zeigen, nicht durch Inszenierung, sondern durch Verlässlichkeit im Tun. Es geht darum, die eigene Wertebasis bewusst und transparent zu machen: im Gespräch, im Ehrenamt, in der Jugendarbeit, im Vereinsleben. Nicht belehrend, nicht überhöht, sondern eingebettet in die gemeinsame Erfahrung, dass Demokratie von gegenseitigem Respekt lebt – und davon, dass jeder Einzelne Teil des Ganzen ist. Eigenverantwortung und soziale Verantwortung sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Aufgabe: die Gesellschaft von innen heraus zusammenzuhalten.
Das ist keine einfache Aufgabe. Aber eine notwendige. Und eine zutiefst politische,
Euer
Michael Hoffschroer